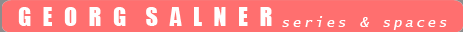back
Vitus Weh
Derzeit erleben wir eine merkwürdige Renaissance der Emblematik. "Omnis
mundi creatura / Quasi liber et figura / Nobis est et speculum": Das Motto
von Alanus de Insulis aus dem 12. Jh. ("Alle Schöpfung dieser Welt / Ist uns
gleichsam dargestellt / Als Spiegel, Buch und Bild") scheint sich problemlos
auf heute übertragen zu lassen. Unser ganzer Alltag ist erfüllt von
Emblemen: Piktogrammen, grafischen Benutzeroberflächen, Werbeimages, Logos,
bedruckten T-Shirts usw. Solche visuellen Kurzschriften wollen nicht sosehr
betrachtet, sondern gelesen werden, auf daß sich eine ganz bestimmte
Information dahinter öffne. Im Grunde entsprechen Embleme einer
Verweisungs-, Entsprechungs- und Lebenslehre, der zufolge die Wirrnis der
Welt in ein Gefüge von Sinnfiguren übersetzbar sei. Und wir alle lieben
diese Signaturen, weil sie uns die allgegenwärtige Komplexität reduzieren.
Diese schematischen Bildformen sind heute für die Wahrnehmung so bestimmend,
daß sie alle anderen Bilder nahezu in den Schatten stellen. Daß sich auch
die Kunst mit dem Phänomen "Emblem" beschäftigt, ist daher wenig
überraschend. Sie tut dies schon seit längerem. Bereits die Kunst des 16.
und 17. Jh.s hat immer wieder gefordert, daß die Maler bei den Dichtern in
die Schule gehen sollen ("ut pictura poesis"). Im barocken Emblem ist diese
Annäherung von Wort und Bild am folgerichtigsten vollzogen worden. Der
ältere und volkstümliche Ausdruck für Emblem ist "Sinnbild". In einem
Universallexikon des 18. Jh.s liest man darüber: "Sinnbild ist ein Gemälde,
welches in einem Bild und in Worten einen verborgenen Sinn erweiset, welcher
zu fernerem Nachdenken veranlasset. Das Bild wird für den Leib, die Schrifft
für die Seele des Sinnbildes geachtet."
In Georg Salners Ausstellung SU.SY scheinen auf den ersten Blick alle
klassischen Elemente solch eines Sinnbildes idealtypisch vorhanden zu sein:
Die kurze Inscriptio als Motto (die Tornamen in weißer Schrift auf schwarzer
Wand), die bildhafte Pictura (die Stuhlreihe und die Fläche aus
Metallplatten), sowie die schriftliche Subscriptio (Salners Auslegungen, die
diesen Text hier umfließen). Doch ganz zu verstehen ist die Sache dann doch
nicht: Warum genügt nicht wie früher eine Emblem-Vignette? Warum braucht es
heute dafür offensichtlich einen ganzen Raum? Und wie kommt es zu diesem
merkwürdigen Überfluß an Deutungen in Salners beigefügtem Text?
Eine Erklärung verbirgt sich in Salners Ansatz, der nicht allein einer
Tradition der Gelehrsamkeit, der Kodierung und Deutung verpflichtet ist,
sondern auch einer ganz bestimmten Auffassung von Malerei. Diese Aspekte des
Malerischen gilt es näher zu betrachten.
Auffallend ist zunächst, daß der von Salner gestaltete Raum als Ganzes das
Bild ist, sodaß weder der Begriff Tafel- noch Wandbild passen will.
Ausdrücke wie "Raumschüttungen" oder "Spatiale Malerei" scheinen näher zu
liegen, aber auch sie treffen das Arrangement dieser mit farbigen Stücken
perforierten Raumschleuse nicht präzise. Die Tradition innerhalb der
zeitgenössischen Kunst, auf die Salner sich beziehen kann, ist noch jung.
Den Beginn des international verstärkten Interesses für raumfüllende
Malereiinstallationen läßt sich ziemlich exakt auf Mitte der achtziger Jahre
datieren. Es war eine Entwicklung, die relativ parallel zur Bewegung der
"Neuen Geometrie" verlief: so unterschiedliche Künstler wie Matt Mullican,
Sol LeWitt und Günter Förg entdeckten damals die Möglichkeit, ihre Malerei,
die sich an der Geschichte der geometrischen Abstraktion oder der
schematischen Kodiertheit der Alltagsästhetik abarbeitete, in die
Dreidimensionalität zu entfalten. Andere, wie Joseph Kosuth, Remy Zaugg und
Gerhard Merz, versuchten ihre Raummalereien zusätzlich noch durch den
Einsatz von Schrift aufzuladen. Heinz Schütz hat dieses Phänomen, das so
auffallend das Erzählerische und Moritatenhafte forcierte, später unter dem
Titel "Das Theater der Embleme" zusammenzufassen versucht: "Das Emblem tritt
auf die Bühne, das von der Malerei hinter die Kulissen gedrängte Wort
erscheint im Bild".1
Parallel zu diesem internationalen Diskurs hat sich in Österreich allerdings
eine lokale Ausprägung ergeben, die in unserem Zusammenhang sehr wichtig
ist: "Theater" bedeutet hier tendenziell etwas anderes als nur "Bühne".
Speziell der Wiener Resonanzraum hat diese Differenz entscheidend geprägt.
Hier galt es eine lebendige Tradition des räumlichen Gesamtkunstwerkes zu
berücksichtigen, die seit den barocken Schloß- und Kirchenanlagen existiert
und sich über die Möblierungen des Historismus' und die umfassenden
Inszenierungen des Jugendstils bis beispielsweise zur "Kleinen Architektur"
der 60er Jahre (Hans Hollein, Hermann Czech u.a.) oder bis zu den
künstlerisch gestalteten Schauräumen des Museums für Angewandte Kunst (MAK)
in den 90er Jahren zieht. Auf diesen Zusammenhang hat Markus Brüderlin
bereits 1986 hingewiesen2 und für die Malerei der neuen Geometrie in
Abgrenzung zur klassischen Moderne und zur amerikanischen
Neo-Post-Konzeptkunst den Einfluß von Seh- und Denkerfahrungen
herausgestrichen, wie sie der Umgang mit dem historisch und ästhetisch
dichten Stadtraum Wien oder auch die Kartografierung der Psyche durch
Sigmund Freud bereithält.
Die Linie dieser in den "ästhetischen Raum" erweiterten Malerei zieht sich
in Österreich im Wesentlichen bis heute. Ihr Feld umfaßt den "Erlebnisraum
Tafelbild" ebenso wie "gestaltete Zwischenräume" und "Settings". Die in
ihnen wirkende "Geräthaftigkeit" ist die Differenz, die sich dabei zum
herkömmlichen "Theater" ergibt. Es handelt sich dabei nicht um
"Bühnenbilder", auf denen ein Stück gegeben wird, sondern um "Malerei" als
der Erzeugung und Widerspiegelung universalistisch gemeinter Denk- und
Lebensräume. Wichtig ist der Unterschied zwischen Dramaturie und
Polytechnik: Die Ausstattung dieser Räume besteht nicht aus Requisiten
sondern aus "Einrichtungen". Wie die Arbeiten von Franz West, Heimo Zobernig
u.a. exemplarisch zeigen, geht es um Körper und ihre Haltungen in diesen
geräthaften Bildräumen; es geht um Räume als Sozialskulpturen.
Vor diesem Hintergrund österreichischer Malereikultur wird auch Georg
Salners SU.SY-Raum durchschaubar. Es klärt sich, warum es dafür einen ganzen
Raum braucht, und was es mit dem Deutungsüberschuß auf sich hat. Bei Salners
Installation handelt sich eben gerade nicht um ein Emblem, das fraglos in
Deutung aufgeht, sondern um eine kleine Maschine, die die explodierenden
Konnotationen, die sich schon bei so etwas Schlichtem wie den vier
Metallsorten Eisen, Kupfer, Silber und Gold einstellen, zu bändigen und zu
kanalisieren versucht. Auf das anschmiegsam-geräthafte der Installation
deutet nicht zuletzt Salner selbst mit dem Titel "SU.SY": Was sich wie ein
lieblicher Mädchenname anhört bezeichnet ein Phänomen der atomaren
Forschung: Daß in Salners Installation die Bedeutungen in einen Kreislauf
versetzt werden, wie die Materie in einem Teilchenbeschleuniger (siehe das
Textfragment von Thomas Kramar über Supersymmetrie), ist ein durchaus
naheliegender Vergleich. Die emblematischen Bedeutungszusammenhänge, die
früher das von ewigen und wahren Bestimmungen durchwirkte Universum
widerspiegeln sollten, sind bei Salners Installation gleichsam in Aufruhr
geraten. Zusammengehalten werden sie nur durch den Raum der Malerei.
1 Heinz Schütz (Hg.) "Das Theater der Embleme", Themenband der
Kunstzeitschrift Kunstforum int., Band 102, Juli/August 1989, S. 48.
2 Siehe Markus Brüderlin (Hg.) "Postmoderne Seele und Geometrie",
Kunstforum int., Band 86, Nov./Dez. 1986.